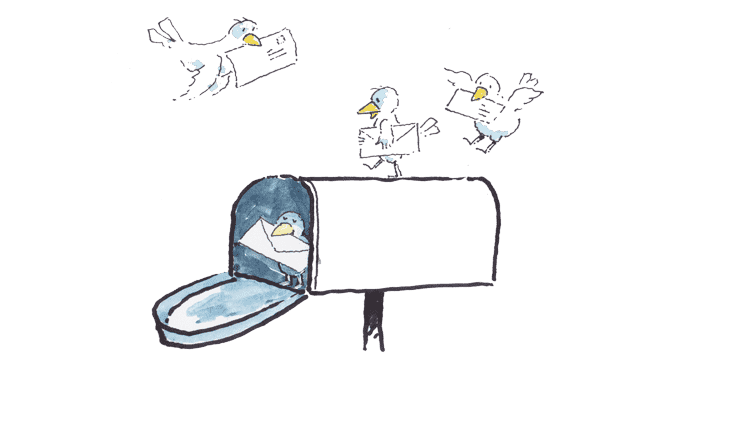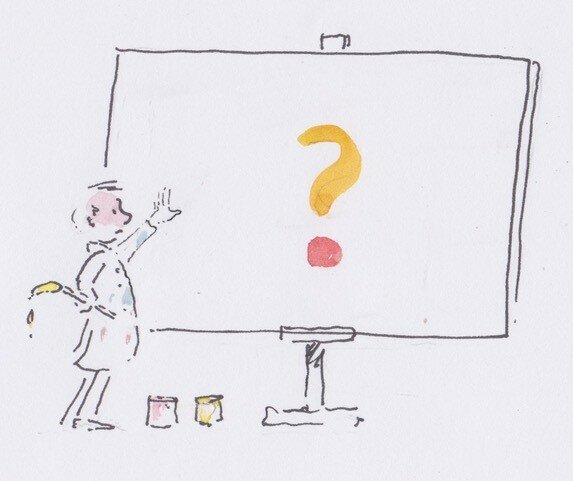
Danke, Herr Haydn
Eine Idee kann mich im Biergarten überraschen, im Bett, beim Zeitunglesen. Hauptsache, sie geht ins Blut, durchläuft das Herz und schafft es bis ins Hirn, wo sie geprüft wird. Wenn sie es schafft, sich auch etliche Tage später noch zu Wort zu melden, weiß ich, dass es Zeit ist, mich an die Arbeit zu machen. Irgendwann liegt das Werk im Buchladen, lockt, bietet sich an, wartet darauf, gekauft zu werden, um sich im Körper des Lesers zu vermehren, auszudehnen, ihn zu besetzen. Wenn ich es schaffe, die Zunge des Lesers zu lösen, damit er die Geschichte weitererzählt, kann es ein Bestseller werden.
Nachfolgend möchte ich einen solche Ideenbefall schildern. Da nicht alle Leser dieses Artikels meine Bücher kennen - was mein Bankdirektor und ich sehr bedauern -, möchte ich ein bekanntes Thema wählen, von dem ich annehmen darf, dass auch der kinderlose Leser schon einmal davon gehört hat: Die Schöpfung.
Ich saß in meinem neuseeländischen Studio, mit Blick auf den Pazifik, klappte meinen Ordner zu, in dem ich die Belege für das hiesige Finanzamt sammele und belohnte mich mit einem Glas Sauvignon Blanc und Haydns Schöpfung, gesungen von Fritz Wunderlich und Gundula Janowitz. Ich hatte dieses Werk schon viele Male gehört, aber noch nie in dieser Besetzung. Es packte mich, riss mich mit, rührte mich zu Tränen. Auf dem Weg zurück zum Wohnhaus durch meinen großen Garten wusste ich, ich bin befallen. Ich muss ein Buch machen, dieser Musik mit meinen Worten und Bildern nahekommen.
Ich konnte kaum den nächsten Tag erwarten, rannte direkt nach dem Frühstück zurück ins Studio und begann mit ersten Ideenskizzen, heftete sie an die leeren weißen Wände. Worte, Zeichnungen, Einfälle. Ein sichtbar gewordenes Leporello meiner Hirnstromkurven. Am deutlichsten sah ich das Paradies vor mir. Es musste so aussehen wie mein eigener tropischer Garten, den ich in zwanzigjähriger Arbeit geschaffen habe. Palmen, blühender Hibiskus, Zitrusbäume, Bananenstauden, in dem sich Wachtelfamilien, Fasane, Eisvögel und Wellensittische tummeln. Alle Bewohner meines kleinen Paradieses wollte ich abbilden. Es gefiel mir, bis ich im New Zealand Herald, unserer hiesigen Zeitung, las, dass das arktische Paradies bedroht sei. Als ich ein Kind war, glaubten die Menschen, dass es nur ein einziges Paradies gab: das tropische. Heute sprechen wir vom Paradies im Plural. Der Urwald, die Wüste, die Arktis, die Berge, das Meer, alle haben eine Stimme bekommen.
Also begann ich erneut mit dem Skizzieren. In meinem Paradies wuchsen jetzt Eisberge für die Pinguine und Berge für die Gämsen und Lianen für die Affen und Sanddünen für die Kamele. Ich war glücklich- bis ich mich mit Gott beschäftigte. Wo sollte ER wohnen? Thronte ER wie in der Sixtinischen Kapelle auf einer Kumuluswolke? Und wie sah ER aus? Hatte ER einen Rauschebart und ein weißes, knöchellanges Leinennachthemd an? Würden die jungen Leser nicht denken, der sieht aus wie unser Opa? Der ist ja viel zu alt und zu schwach, um die Welt und den Himmel zu schaffen.
Sollte ich Gott ein Siegfried-Image geben, oder aus ihm ein Muskelpaket wie Arnold Schwarzenegger machen?
Meine Arbeit geriet ins Stocken, denn ich wollte auch noch das Thema Evolution einbeziehen. Die Schöpfung ist ein evolutionärer Prozess, seit es Leben gibt auf unserem Planeten. Wie konnte ich es so darstellen, dass auch die Kinder es begreifen würden?
Ich verschob das Projekt, wie so oft, arbeitete an anderen Themen, aber die Idee hatte sich wie ein Parasit in der linken, schöpferischen Hirnhälfte verkapselt und wartete darauf, befreit zu werden. Sie meldete sich zwei Jahre später während einer Europareise. Ich besuchte eine Ausstellung in Paris, Monet, ein Maler, den ich sehr verehre. Auf einem alten schwarz-weiß-Foto stand er vor seiner Staffelei und schaute mich an, Palette und Pinsel in der Hand. Er trug eine bekleckerte helle Jacke, hatte einen Strohhut auf dem Kopf und einen weißen Siegmund Freud-Bart. Der Kopf meldete: Habe Gott gesehen. Schlagartig wurde mir bewusst, dass Monets Studio der ideale Ort war, um Darwins Evolution gerecht zu werden. Ich könnte darin Gottes frühe Entwürfe zeigen, die Saurier, Säbelzahntiger, Neandertaler oder lebensuntüchtigen Einzeller.
Noch nie habe ich mich so auf den langen 24stündigen Rückflug nach Neuseeland gefreut , um in meinem Studio weiter zu arbeiten. Gott, der große Ähnlichkeit mit Monet hatte, machte sich gut in seinem Atelier. ER war glaubwürdig, kraftvoll, liebenswert. Man nahm IHM ab, dass er trotz seines Alters stark genug war, um Adam und Eva zu schaffen und ihnen das Leben einzuhauchen. Doch welche Gestalt sollte ich ihnen geben? Im Mittelalter sahen Adam und Eva uralt aus. Adam hatte einen Vollbart und Eva einen Hängebusen. Beide waren runzelig und gebeugt. Die damaligen Künstler stellten sie als unsere Großeltern dar. Die Renaissance- Maler verjüngten das erste Menschenpaar. Plötzlich waren sie kraftvolle Twens. Prall und herrlich in ihrer Nacktheit anzuschauen. Ich erlaubte mir, Adam und Eva eine Kindheit zu schenken. Jetzt waren alle Probleme gelöst.
Es war Zeit, alle Bilder abzuhängen und sie mit der Geschichte beiseite zu legen. Das mache ich mit all meinen Büchern. Ich will Abstand bekommen zu meinem eigenen Tun. Will es mit frischen Augen Monate später erneut betrachten, um Schwächen zu erkennen in Wort und Bild – was meist der Fall ist. Dann überarbeite ich das Buch noch einmal und schicke es meinem Verleger.
P.S. ich hoffe, dass die Zeiten sich nicht so schnell ändern, damit ich noch viele meiner Ideen verwirklichen kann